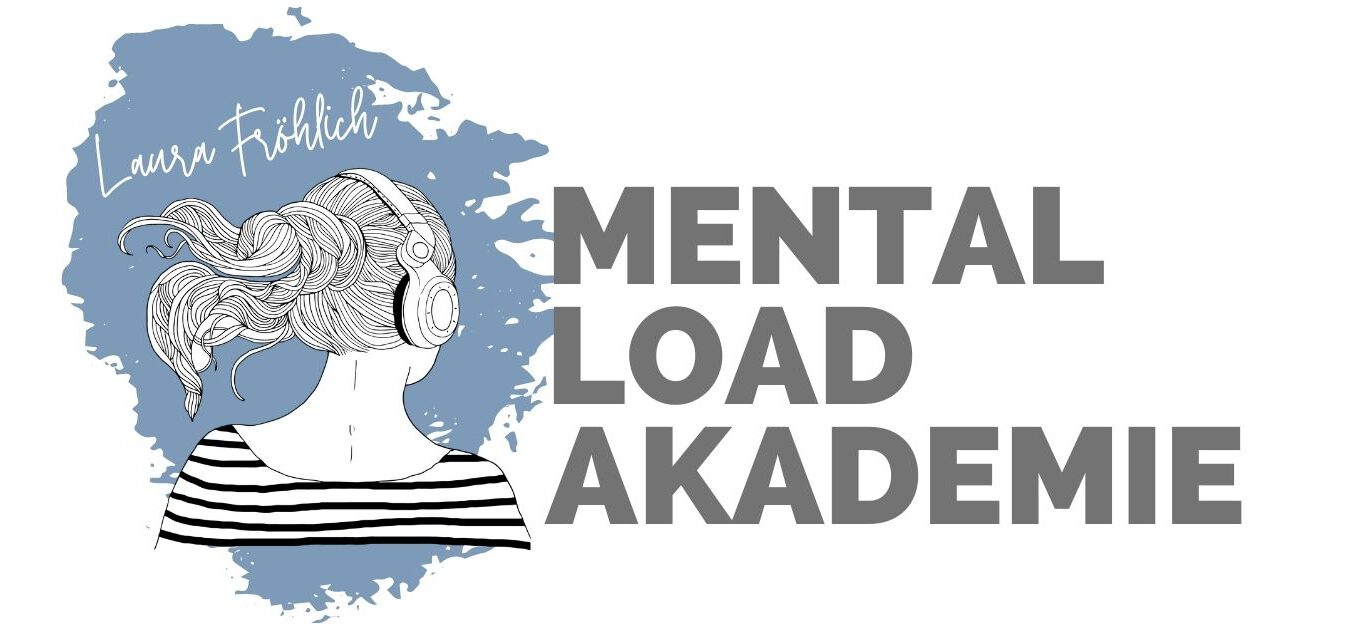Manchmal finde ich mich in all den Wäschebergen wieder und bin einfach nur frustriert. Es findet kein Ende, diese Arbeit. Und sie wird nie fertig. So ein Projekt im Büro ist irgendwann abgeschlossen. Wenn es gut gelaufen ist, gibt es lobende Worte vom Chef oder von den Kollegen. Das Gefühl, die Aufgabe zu den Akten zu legen, ist schön. Am Ende des Monats fließt Geld auf das Konto. Davon können Miete, Essen und Schulhefte bezahlt werden.
Selbstwirksamkeit, Wertschätzung und die Freiheit, an der eigenen Situation etwas ändern zu können, das ist unser Lebenselexier, wenn es um Arbeit geht. Haushalt ist auch Arbeit, eine Menge sogar, aber ich habe keine Lust mehr darauf. Ich finde mich in all den Wäschebergen wieder und weiß nicht, wie ich da hingekommen bin.
Ich putze die Fenster und eine halbe Stunde später patschen drei Schulkinder dagegen und drücken ihre Nasen an die Terrassentür. Ich koche gesund, kindgerecht und lecker und alle rufen „Bäääh!“. Ich arbeite mich durch drei Kisten Schmutzwäsche und am Ende des Tages ist die Wäschekiste wieder voll. Das sind Momente, in denen ich Selbstwirksamkeit und Wertschätzung schmerzlich vermisse. Aber was mich wirklich traurig macht, ist die mangelnde Freiheit.
Die Freiheit zu sagen: heute mache ich mal gar nichts, lass alles, wie es ist. Oder zu wissen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist und mich bald Jemand ablöst, der die Wäscheberge abträgt. Oder sagen zu können „nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Bitte noch einmal auf Anfang.“
Hausarbeit kann manchmal befreiend sein. Ich habe schon in meiner Wäschekammer gestanden und Wäsche gefaltet, dabei meinen Gedanken nachgehangen und mich über die verrichtete Arbeit gefreut. Ein bezahlter Job kann manchmal frustrierend sein. Zu viel zu tun, nervige Kollegen oder ein cholerischer Chef – Alles hat zwei Seiten.
Manchmal finde ich mich in all den Wäschebergen wieder und bin einfach nur genervt. Weil ich es hasse, in diese Frauenfalle getappt zu sein. Als junges Mädchen dachte ich, das Geschlecht sei egal. Sang laut mit, wenn ich unsere Kinderkassetten hörte: „Mädchen, lasst euch nicht verbieten, was ein Junge machen darf.“ Wir leben in einer modernen Zeit und ich kann alles schaffen, was der Typ in der Schulbank neben mir schaffen kann. Dann bin ich Mutter geworden und hart auf die Nase gefallen.
Manchmal finde ich mich zwischen Wäschebergen wieder und bin einfach nur verzweifelt. Weil nicht nur ich hier stehe, sondern auch meine Freundin Tina. Ebenso meine alte Klassenkameradin Corinna, Nachbarin Bianca und Cousine Klara. Die eine macht es gerne, die andere nicht.
Manchmal finde ich mich zwischen Wäschebergen wieder mit einem Buch, das den Titel „Die deutsche Mutter“ trägt. Darin lese ich, während ich auf Matschhosen und Pullovern mit Ketchup-Flecken sitze, dass das alles System hat. Dass nur wir hier in Deutschland so leben, weil das Mutterbild ein spezielles ist. Weil wir daran glauben, dass die Mutter für das traute Heim, der Vater für die harte Arbeitswelt zuständig ist.
Manchmal finde ich mich zwischen Wäschebergen wieder und möchte jeden einzelnen schmutzigen Strumpf über eine Fackel ziehen und die dreckigen Handtücher zwischen zwei Stäbe spannen, mit roter Farbe „Aufstand“ darauf sprühen und mit Tina, Corinna, Bianca, Klara und meiner Tochter auf die Straße gehen und demonstrieren wie die Isländerinnen. Wir zünden die Fackeln an und kämpfen gemeinsam für eine Welt, in der wir die gleichen Chancen haben wie die Männer. Für eine Welt, in der Care-Arbeit gewertschätzt und gerecht verteilt wird. Für eine Welt, in der wir die freie Wahl haben.
Bleib fröhlich und unperfekt, deine Laura